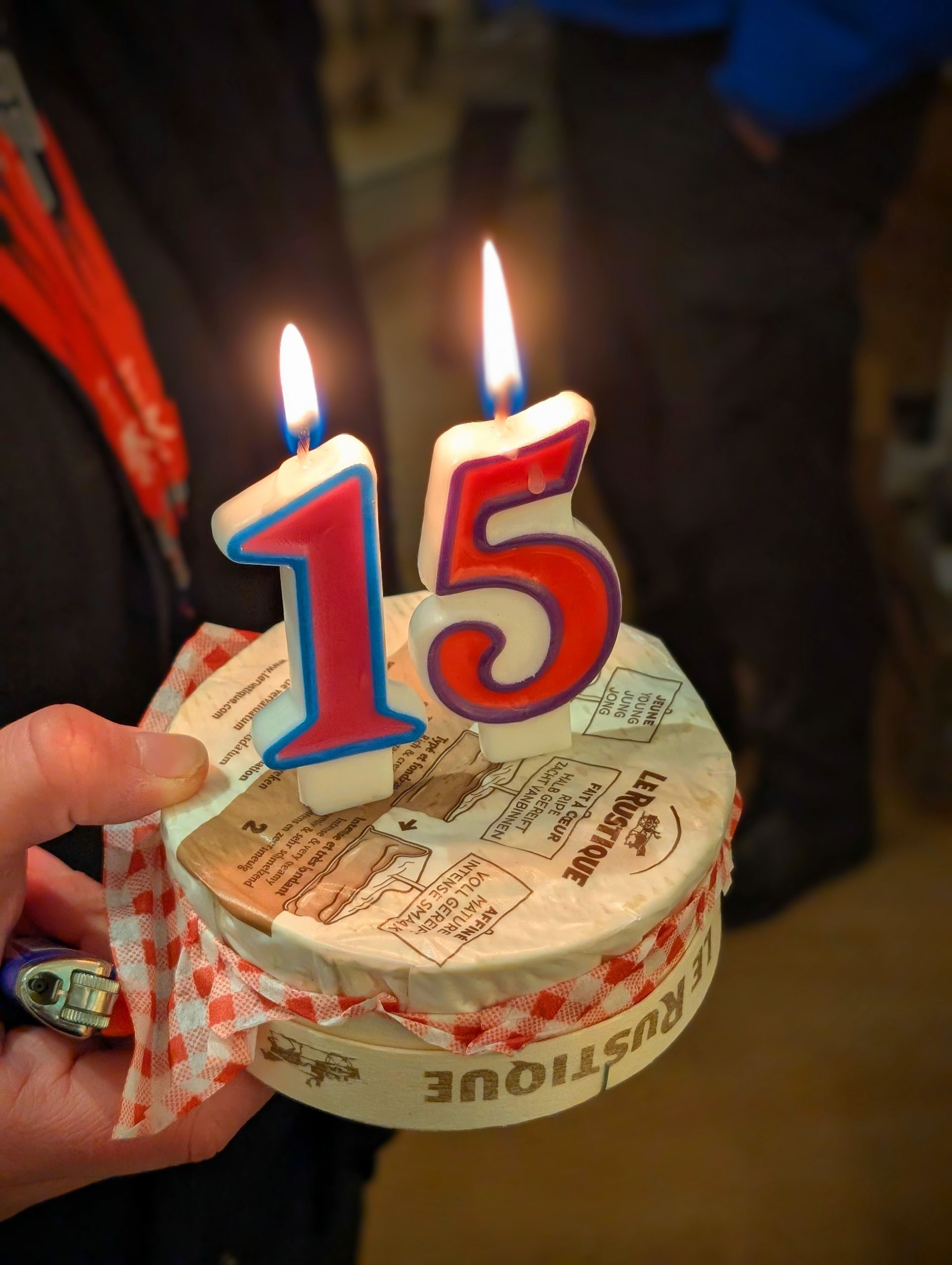Deutscher Branntwein und seine Rolle im Kolonialismus
Das Verhältnis von deutschem Branntwein, den Kolonien und den Kolonialverbrechen ist ein oft übersehener, aber bedeutender Aspekt der deutschen Kolonialgeschichte. Alkohol, insbesondere Branntwein, spielte eine zentrale Rolle in der kolonialen Wirtschaft, wurde als Handelsware genutzt und hatte verheerende soziale Folgen für die einheimische Bevölkerung in den Kolonien.
Branntwein als Kolonialware und Zahlungsmittel
Deutscher Branntwein wurde in großen Mengen in die deutschen Kolonien exportiert, insbesondere nach Deutsch-Ostafrika (heutiges Tansania, Ruanda, Burundi), Deutsch-Südwestafrika (heutiges Namibia), Kamerun und Togo. Er wurde dort als Zahlungsmittel im Handel mit Einheimischen eingesetzt, oft im Tausch gegen landwirtschaftliche Erzeugnisse, Arbeitskraft oder andere Rohstoffe.
- Branntwein als "Währungsersatz": Alkohol war billig in der Produktion, leicht zu transportieren und wurde als Mittel genutzt, um Einheimische an das koloniale Wirtschaftssystem zu binden.
- Zerstörung lokaler Gesellschaften: Der hohe Alkoholkonsum führte zu sozialem Zerfall, Gewalt und einer Schwächung traditioneller Strukturen.
Kritik an der „Branntweinpolitik“: Bereits zeitgenössische Stimmen, darunter Missionare, kritisierten den Alkoholhandel als eine bewusste Strategie zur Kontrolle und Schwächung der einheimischen Bevölkerung.
Deutsche Kolonien und der "Branntweinparagraf"
Die negativen Auswirkungen des Alkoholkonsums wurden so offensichtlich, dass das Deutsche Reich 1886 den sogenannten Branntweinparagrafen (auch "Spiritusverbot") in der Kolonialgesetzgebung einführte. Dieses Gesetz untersagte offiziell den Import und Verkauf von starkem Alkohol in deutschen Kolonien.
- Aber: Heuchelei und Umgehung des Gesetzes – In der Praxis war das Verbot oft wirkungslos, da große Kolonialgesellschaften und Händler Wege fanden, es zu umgehen. Alkohol wurde weiterhin illegal eingeführt oder unter anderem Namen verkauft.
- Doppelmoral – Während der Alkoholhandel mit Einheimischen eingeschränkt wurde, blieb Branntwein für europäische Siedler, Soldaten und Beamte leicht verfügbar.
Alkohol als Instrument der Unterdrückung und Kontrolle
Branntwein wurde nicht nur als Handelsware, sondern auch gezielt als Mittel zur Kontrolle der kolonisierten Bevölkerung eingesetzt:
- Zwangsarbeiter und Alkohol: In vielen Plantagen und Minen wurde Branntwein als Teil des Lohns ausgegeben. Dies führte zu Abhängigkeit und machte Arbeiter leichter ausbeutbar.
- Alkohol als Kriegsstrategie: Während des Maji-Maji-Aufstands (1905–1907) in Deutsch-Ostafrika, einem der brutalsten Kolonialkriege, wurde Alkohol gezielt genutzt, um Kämpfer zu schwächen oder kollaborierende Eliten gefügig zu machen.
- Systematische Zerstörung lokaler Kulturen: Der exzessive Alkoholkonsum unterminierte traditionelle Gesellschaften, was langfristig zu sozialen Problemen führte, die bis heute in ehemaligen Kolonien spürbar sind.
Kolonialverbrechen und die Rolle des Branntweins
Die Verbindung von Alkoholpolitik und kolonialer Gewalt zeigt sich besonders deutlich in Deutsch-Südwestafrika (Namibia) während des Völkermords an den Herero und Nama (1904–1908):
Nach dem Aufstand der Herero und Nama gegen die deutsche Kolonialherrschaft wurden Tausende in Konzentrationslagern interniert.
In diesen Lagern herrschten unmenschliche Bedingungen: Zwangsarbeit, Hunger, Misshandlungen – und oft wurde Branntwein genutzt, um Häftlinge "ruhigzustellen" oder sie zu bestrafen.
Berichte von Zeitzeugen belegen, dass Alkoholkonsum auch in der deutschen Armee weit verbreitet war, was zu noch extremeren Gräueltaten führte.
Kontinuitäten und Langzeitfolgen
Auch nach dem Ende der deutschen Kolonialherrschaft (1919) blieb der Schaden, den die Branntweinpolitik angerichtet hatte, bestehen: Viele der Alkoholprobleme in ehemaligen deutschen Kolonien gehen auf diese Zeit zurück. In Namibia und Tansania gibt es bis heute Debatten über die Verantwortung Deutschlands für die langfristigen sozialen und gesundheitlichen Folgen der kolonialen Alkoholpolitik.
Die Diskussion um Reparationen und Entschädigungen für Kolonialverbrechen berücksichtigt oft wirtschaftliche Ausbeutung, aber selten die destruktive Rolle des Branntweins.
***
Deutscher Branntwein war ein entscheidendes Werkzeug der Kolonialherrschaft: als Zahlungsmittel, als Strategie zur Kontrolle der Bevölkerung und als Mittel zur sozialen Destabilisierung. Trotz offizieller Verbote blieb Alkohol ein zentrales Element der kolonialen Wirtschaft – mit verheerenden Folgen. Die Aufarbeitung dieser Geschichte steckt noch in den Anfängen, aber sie ist ein wichtiger Teil des deutschen Kolonialismus, der oft übersehen wird.